
Unser Arbeitsbegriff von Partizipation
Wir bezeichnen diese Definition als „Arbeitsbegriff“, weil wir selber in Sachen Partizipation ständig weiterlernen und keine endgültige Begriffsbestimmung anstreben. Wir dokumentieren hier (in Kürze) das augenblickliche Essential unseres Selbstverständnisses.
Partizipation verstehen wir als das Recht auf freie, gleichberechtigte und öffentliche Teilhabe der BürgerInnen, an gemeinsamen Diskussions- und Entscheidungsprozessen in Gesellschaft, Staat und Institutionen, in institutionalisierter oder offener Form. Partizipation ist aktive Praxis von Demokratie durch die Subjekte in der Gesellschaft. In einer Demokratie wird Partizipation nicht gewährt, sondern sie ist grundsätzlich ein Recht der Gesellschaftsmitglieder. Partizipation von Kindern und Jugendlichen meint, dass auch sie das Recht und die Fähigkeit zur Teilhabe am demokratischen Prozess haben, und zwar in allen sie betreffenden gesellschaftlichen Feldern und Fragen. Kinder und Jugendliche sind Träger der im Grundgesetz gewährten Rechte. Sie sind BürgerInnen dieses Staates und ihnen stehen wie allen Grund- und Beteiligungsrechte zu. Trotz der allgemeinen grundgesetzlichen Bürgerrechte fehlen gesetzliche Regelungen, die die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen differenzieren und sichern. Bisherige Regelungen verbleiben eher bei Mitsprache- und Mitwirkungsrechten und geben Kindern und Jugendlichen keine (Mit-)Entscheidungsmacht.
Mit dieser normativen Begriffsbestimmung wird an eine Tradition emanzipatorischer Partizipation (und Pädagogik) angeschlossen die auf Selbstbestimmung der Subjekte/BürgerInnen in einem mitverantwortlichen gesellschaftlichen Konflikt- und Aushandlungsprozess zielt. Mitsprache, Mitwirkung und Mitbestimmung reichen aus dieser Perspektive nicht aus: erst mitverantwortliche Selbstbestimmung erfüllt die Ansprüche solcher Partizipation. Pädagogisch geht es damit um eine Bereitstellung von Freiräumen der mitverantwortlichen Selbstbestimmung in einer Sozietät, die als Recht verstanden und einforderbar sein müssen. Partizipation muss so gestaltet werden, dass sie ein Mehr an Mit- und Selbstbestimmung der Kinder und Jugendlichen herausfordert und auch ihre Fehler, mangelnden Kompetenzen, Rückschritte als Aspekte des Lernprozesses zu mehr Demokratie versteht.
Man kann davon ausgehen, dass dieser konzeptionelle pädagogische Anspruch im Alltag pädagogischer Einrichtungen nach wie vor kaum eingelöst ist. Zudem muss immer beachtet werden, welche Partizipationsmöglichkeiten und Grenzen die jeweilige Einrichtung, aber auch die spezifischen Kinder und Jugendlichen mitbringen. Die konzeptionelle Radikalität des Partizipationsanspruchs macht dennoch alle „kleinen“ Anstrengungen nicht sinnlos, auch wenn sie diesen Anspruch (noch) nicht erfüllen, aber im Blick auf dieses Fernziel agieren. Nicht erst das leuchtende Ziel „Selbst- und Mitbestimmung“ gilt, sondern alle Zwischenstufen auf dem Weg dahin, wenn sie angemessen an Entwicklungsstand und Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen eine Weiterentwicklung zumuten. Im Sinne emanzipatorischer Partizipation gilt es, sich für eine Ausweitung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Dabei sind auch die kleinsten Versuche nützlich.
Partizipation steht in engem Zusammenhang mit der aktuellen Bildungsdiskussion als auch mit der Zielsetzung „Demokratie lernen“.

Demokratiebildung und Partizipation
Auch das Lernen von Demokratie ist in erster Linie ein Bildungsprozess. Demokratische Kompetenzen können kaum von außen „theoretisch“ vermittelt, sondern sie müssen von den Kindern und Jugendlichen handelnd immer wieder erfahren werden.
Demokratisches Handeln verlangt die Fähigkeit, die eigenen Interessen zu kennen, die Interessen anderer wahrnehmen und einbeziehen zu können, sich mit anderen auseinandersetzen zu können, in der Lage zu sein, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und die Folgen unterschiedlicher Entscheidungen abschätzen zu können.
Diese Kenntnisse und Fertigkeiten erfahren Kinder und Jugendliche vor allem dann, wenn sie sich selbst in ihre Angelegenheiten einmischen – wenn sie sich an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt beteiligen. Partizipation wird so zum Schlüssel für den Erwerb demokratischer Kompetenzen, demokratischer Haltungen und demokratischer Handlungsfähigkeit.
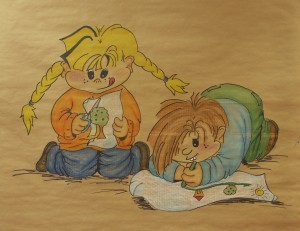
Bildung und Partizipation
Wir verstehen Bildung als Prozess und Ergebnis der aktiven Aneignung von Selbst- und Welt in ihrem Zusammenhang. Bildung ist selbsttätige Aneignung des Subjekts in Sozietäten. Bildung zielt auf die Entwicklung mitverantwortlicher Selbstbestimmung des eigenen Lebens in der Gesellschaft.
Die (Selbst‑)Bildung von Kindern und Jugendlichen zu begleiten erfordert, sie als Subjekte wahrzunehmen und ihre individuelle Sicht der Welt zum Ausgangspunkt pädagogischer Arbeit zu machen, mit anderen Worten: sie zu beteiligen.
Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen wird damit zu einer zentralen Aufgabe bildungsbegleitender Pädagogik. Wenn man ihre Themen und Handlungen selbsttätiger Bildung pädagogisch unterstützen will, macht man die Kinder zu den „BestimmerInnen“; es gilt dann, was für sie und ihre Bildung wichtig ist. Wenn Bildung auf mitverantwortliche Selbstbestimmung zielt, müssen Kinder und Jugendliche erkennen können, dass sie das Subjekt der eigenen Bildung sind. Sie müssen in ihren Interessen und Bildungsbewegungen ernst genommen und unterstützt werden. Es geht eben nicht darum, dass Erwachsene aufmerksam die Bildungsbewegungen der Kinder und Jugendlichen beobachten, sie auswerten, didaktisch zubereiten und sie ihnen dann quasi aus der Hand des Erwachsenen zurückspielen. Kinder und Jugendliche erleben sich dann nicht als aktive Produzenten und Entscheider eigener Lerntätigkeit, sondern als von Erwachsenen gesteuert. Mit einer solchen pädagogischen Strategie würden Kinder und Jugendliche in ihren eigenen Themen und Bildungsbewegungen enteignet, sie würden entmündigt.
Es geht vielmehr darum, Bildungskonzepte zu entwickeln, die Partizipation der Kinder und Jugendlichen integrieren. Die Kinder und Jugendlichen müssen erkennen können, dass sie es sind, die die Themen und Settings bestimmen. Sie müssen die PädagogInnen als kooperative AnregerInnen und BegleiterInnen ihrer (Selbst-)Bildung erfahren und nicht als ausschließliche MachthaberInnen. Die Methoden und Strukturen von Partizipation in den pädagogischen Einrichtungen sollen dabei helfen. In diesem Sinne wird die Orientierung an den Interessen der Kinder und Jugendlichen, ihre Beteiligung an allen sie betreffenden Angelegenheiten zum Schlüssel für Bildungsprozesse und Bildungskonzepte. Partizipation ist dann nicht ein Ziel neben anderen. Partizipation ist der Schlüssel zur Bildung.
